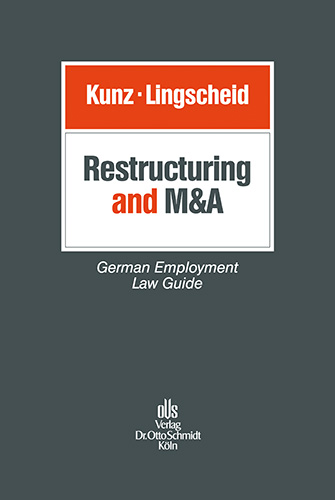CR - Computer und Recht Zeitschrift für die Praxis des Rechts der Informationstechnologie
Folgende Rubriken sind enthalten: IT und Software, Daten und Sicherheit, Internet und E-Commerce, Telekommunikation und Medien, Report und Technik Wissenschaftlich fundiert und für die Praxis aufbereitet. Inklusive der Zeitschrift CRI – Computer Law Review International und inklusive Beratermodul CR - Computer und Recht. Mit Beiträgen zum Selbststudium nach § 15 FAO.
CR digital nutzen in Otto Schmidt online:
Alternativ zum Print-Abo steht die Zeitschrift in digitalen Modulen in Otto Schmidt online zur Verfügung: Das Start-Abo der Module läuft 3 Monate zum Preis von 2 Monaten:
Beratermodul IT-Recht
Beratermodul CR - Computer und Recht
CR bei juris:
juris IT-Recht
- Antworten auf bislang ungelöste Fragen des IT-Rechts
- Analysen zu Rechtsprechungstrends und Gesetzgebungsvorhaben
- Mit Beiträgen zum Selbststudium nach § 15 FAO
- Inklusive Beratermodul CR
- Zeitschriften-App (Otto Schmidt Zeitschriften-App)
Beschreibung
Wissenschaftlich fundiert und für die Praxis aufbereitet: Experten strukturieren und beantworten bislang ungelöste Fragen des IT-Rechts und zeigen die Trends der Rechtsentwicklung auf.
Ausführlich und übersichtlich am Puls der Zeit: Analysen zu Rechtsprechungstrends, Gesetzgebungsvorhaben auf nationaler und europäischer Ebene sowie die maßgebliche Rechtsprechung im Originaltext.
Strukturiert in 5 Rubriken: IT und Software, Daten und Sicherheit, Internet und E-Commerce, Telekommunikation und Medien, Report und Technik
Vorsprung durch Rechtsvergleich: State-of-the-art Denk- und Lösungsansätze und Rechtsprechung aus anderen Jurisdiktionen auf Englisch – online only in der Zeitschrift Computer Law Review International (CRi)
Beratermodul CR: Online-Zugriff auf alle Inhalte von CR seit 1985, 12 Ausgaben pro Jahr, sowie CRi seit dem Jahr 2000, 6 Ausgaben pro Jahr. Inklusive Volltexte zu Gesetzen und Entscheidungen.
Im Print-Abonnement enthalten die Online-Datenbank zur Zeitschrift
Beziehern der CR steht im Rahmen ihres Abonnements das Beratermodul CR, mit folgenden Inhalten, zur Verfügung.
Archiv der Zeitschrift CR seit 1985
Archiv der Zeitschrift CRi seit 2000
IT-rechtliche Gerichtsentscheidungen im Volltext, Gesetzestexte
Online-Inhaltsverzeichnis vorab per E-Mail
Inklusive Selbststudium nach § 15 FAO mit Lernerfolgskontrolle und Fortbildungszertifikat
Nach Abschluss Ihrer Bestellung erhalten Sie neben der Bestellbestätigung eine weitere E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten zu Ihrem Beratermodul in Otto Schmidt online und einen Freischaltcode, mit dem Sie bei Bedarf zwei weitere Nutzer für das Beratermodul freischalten können.
Bestandskunde und Code nicht mehr zur Hand? Dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice unter Telefon (0221) 93738-997, E-Mail kundenservice@otto-schmidt.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Ihre Otto Schmidt Zeitschriften-App – jetzt inkl. Selbststudium nach § 15 FAO
Lesen Sie Ihre Zeitschrift via App mobil auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Sammeln Sie dabei auch Fortbildungspunkte: mit der integrierten Lernerfolgskontrolle im Selbststudium gem. § 15 FAO. Exklusiv für Abonnenten der Zeitschriften und Beratermodule. Laden Sie die App „Otto Schmidt Zeitschriften“ im App-Store oder bei Google play. Anmeldung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort aus der Datenbank Otto Schmidt online. Eine ausführliche Erläuterung zu allen Funktionen der App erhalten Sie hier im Erklärvideo!
Entdecken Sie jetzt unseren IT-Recht Blog. Profitieren Sie von Expertenmeinungen und aktuellen Recherchen, die Ihnen in der täglichen Praxis von großem Nutzen sein können. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand, indem Sie unseren Blog regelmäßig besuchen und sich umfassend informieren.
Erscheinungsweise:
1 x monatlich am 15.
Aktuelles Heft
Heft 1/2026
IT und Software
Aufsätze
Streitz, Siegfried / Schneider, Jochen, Urheberrechtschutz für Computerprogramme, CR 2026, 1-9
Der Beitrag untersucht die sich öffnende Schere zwischen den von der Rechtsprechung angewandten Kriterien und der real urheberrechtsschutzbedürftigen Programmierung (I.). Dazu werden zunächst die von der Rechtsprechung seit den 80er Jahren bis Werbeblocker IV und Action Replay II des BGH entwickelten Kriterien für die Schutzfähigkeit skizziert (II.). Dem werden sodann aktuelle technische Vorgehensweisen bei der Softwareentwicklung gegenübergestellt (III.). Daraus ergibt sich ein zunehmender Anpassungsbedarf (IV.), für dessen Diskussion zwei Richtungen vorgeschlagen werden (V.).
Sassenberg, Thomas / Hunstein, Dorothee, Der Einsatz von KI-Systemen zur Erfüllung der eigenen Leistungsverpflichtungen – Vertragliche Pflichten und Auswirkung auf die Vertragsgestaltung, CR 2026, 10-16
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Rahmen der Erfüllung der eigenen Leistungsverpflichtungen ist inzwischen zum Alltag geworden. Der Beitrag geht anhand von drei typischen Fallkonstellationen auf den regulatorischen Rahmen (II.), die vertraglichen Pflichten (III.) sowie die Folgen für die Vertragsgestaltung (IV.) ein.
Daten und Sicherheit
Voigt, Paul / Schmalenberger, Alexander, Das BSI-Gesetz nach der NIS-2-Umsetzung – Überblick für die Praxis, CR 2026, 17-25
Mit dem am 6.12.2025 in Kraft getretenen NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG) vollzieht sich ein Paradigmenwechsel im IT-Sicherheitsrecht. Das BSI-Gesetz hat sich vom Schutzinstrument für kritische Infrastrukturen zum zentralen Stammgesetz der deutschen Cybersicherheit entwickelt. Der Anwendungsbereich erweitert sich von ca. 1.200 kritischen Anlagen auf rund 30.000 “Einrichtungen“. Der Beitrag bietet einen detaillierten Überblick über den Geltungsbereich, das Pflichtenprogramm, die verschärften Sanktionen sowie die praktischen Auswirkungen für betroffene Unternehmen.
Hartung, Jürgen, Die divergierende höchstrichterliche Rechtsprechung zum immateriellen Schadenersatz wegen Kontrollverlust nach Art. 82 DSGVO, CR 2026, 25-32
Der Beitrag stellt die Rechtsprechungslinie des BGH (I.) und die des EuGH (II.) zu den Voraussetzungen eines Anspruchs auf immateriellen Schadensersatz wegen Kontrollverlust dar und arbeitet im Einzelnen die Abweichungen des Ansatzes des BGH mit den Vorgaben des EuGH heraus (III.).
Rechtsprechung
BGH v. 14.10.2025 - VI ZR 431/24, BGH: Zulässigkeit der Übermittlung von Positivdaten an SCHUFA, CR 2026, 32-37
BGH v. 28.8.2025 - VI ZR 258/24, BGH: Dynamische IP-Adresse als personenbezogenes Datum; immaterieller Schadensersatzanspruch bei provoziertem DSGVO-Verstoß, CR 2026, 37-41
VG Berlin v. 14.10.2025 - 1 K 74/24, ECLI:DE:VGBE:2025:1014.1K74.24.00, VG Berlin: Keine gemeinsame Verantwortlichkeit bei DSGVO-Verstoß im “Lettershop“-Verfahren, CR 2026, 42-45
Internet und E-Commerce
Aufsätze
Quiel, Philipp / Kukin, Ilia / Piltz, Carlo, Bestandskundenwerbung nach der “Inteligo Media“ Entscheidung des EuGH, CR 2026, 45-51
Der EuGH hat in C-654/23 klargestellt, dass bei Bestandskundenwerbung nach Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO nicht zur Anwendung kommen. Damit rückt das Urteil von der bisherigen Behördenpraxis ab. Darüber hinaus erweitert der EuGH mit seiner Auslegung des Verkaufsbegriffs den Anwendungsbereich der Bestandskundenausnahme. Dieser Beitrag beleuchtet die praktischen Folgen der Entscheidung, die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung sowie die nach dem EuGH-Urteil verbleibenden offenen Fragen.
Rechtsprechung
BGH v. 22.10.2025 - I ZR 192/24, BGH: Beginn der Widerrufsfrist im Fernabsatz, CR 2026, 51-57
BGH v. 2.10.2025 - III ZR 173/24, BGH: Nichtigkeit eines Coaching-Vertrages wegen fehlender Zulassung nach FernUSG, CR 2026, 57-59
BGH v. 11.9.2025 - I ZR 14/23, BGH: Werbung im Online-Handel mit “Bequemer Kauf auf Rechnung“, CR 2026, 59-62
Telekommunikation und Medien
BGH v. 23.10.2025 - III ZR 147/24, BGH: Unwirksame AGB-Klausel zur Kundenidentifizierung für SIM-Sperrung, CR 2026, 62-66
Report und Technik
Aufsätze
Käde, Lisa, Datenlos durch die Nacht – Von “Memorization“ zur Vervielfältigung in KI-Modellen, CR 2026, 67-72
Der Beitrag bietet zunächst einen kurzen Überblick über das Verfahren vor dem LG München (I.) und geht sodann auf die Kernfragen der Anwendbarkeit und Reichweite der Text- und Data Mining-Schranken im Rahmen des KI-Trainings (III.) und der “Memorisierung“ von Trainingsdaten (IV.), bevor auf die Verantwortlichkeit für rechtsverletzenden Output (V.) eigegangen und mit einem Ausblick (VI.) geschlossen wird.
IT und Software
Wasilewski, David, OLG Hamburg: Zulässigkeit der Verwendung von Fotografen-Material für KI-Training, CR 2026, R4
Daten und Sicherheit
Pfeiffer, Jan, EuGH: Kein Provider-Privileg für Verarbeitung personenbezogener Daten, CR 2026, R5
Pfeiffer, Jan, BGH: Keine sofortige Verpflichtung zur Löschung bei Schufa, CR 2026, R5-R6
Internet und E-Commerce
Pfeiffer, Jan, LG Berlin II: Booking.com gegenüber Hotelbetreibern schadensersatzpflichtig, CR 2026, R6-R7
Pfeiffer, Jan, AG München: Rücktrittsrecht nach fehlender Aufklärung bei Online-Buchung, CR 2026, R7-R8
TK und Medien
Pfeiffer, Jan, LG München I: Unzulässigkeit der Einführung von Werbung bei Prime Video, CR 2026, R8-R9
Pfeiffer, Jan, VG Düsseldorf: Keine Sperrung pornografische Internetangebote, CR 2026, R9
Autoren und Redaktion
Schriftleitung:
RA Dr. Malte Grützmacher, LL.M. (London), Hamburg;
RA Prof. Niko Härting, Berlin;
RA Sven-Erik Heun, Frankfurt a.M.;
RA Thomas Heymann, Frankfurt a.M.;
RA Prof. Dr. Jochen Schneider, München;
RA Prof. Dr. Fabian Schuster, Düsseldorf;
Prof. Dr. Indra Spiecker gen. Döhmann, LL.M. (Georgetown Univ.).
Herausgegeben gemeinsam mit DGRI e.V.
RA Ulrich Gasper, LL.M. (Edinburgh) (verantwortl. Redakteur)
Veronika Schindhelm (Redaktionsassistentin), jew. Anschrift des Verlags, Tel. 02 21/9 37 38-1 80, Fax 02 21/9 37 38-9 03, E-Mail: computerundrecht@otto-schmidt.de.
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller Verlag Dr. Otto Schmidt KGGustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Köln
E-Mail: